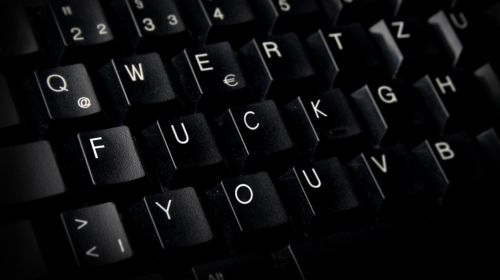
Mobbing, das nie endet
Schüler missbrauchen das Internet für Beleidigungen – auch in Wuppertal – Thema 08/15 Digitalis
Wie schnell der Missbrauch von sozialen Medien in den Alltag von Kindern eingreifen kann, erlebten zahlreiche Wuppertaler Schüler Anfang des vergangenen Jahres. Damals gründeten bis heute unbekannte Nutzer eine Facebook-Gruppe, die ihresgleichen suchte. Dort wurde dazu aufgerufen, Gerüchte über Wuppertaler zu veröffentlichen – ungeprüft, unkommentiert und in der Regel unverschämt. Unter den Opfern befanden sich auch zwei Mädchen aus Ronsdorf. Als sie von üblen Nachreden betroffen waren, verweigerten sie es tagelang, zur Schule zu gehen. Lehrer und Eltern schalteten die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ein. Die Facebook-Gruppe und mehrere Ableger, die schnell aus dem Boden sprossen, wurden aus dem Netz genommen. Trotzdem konnten die Ermittler nie abschließend klären, wer für die einzelnen Straftaten verantwortlich war.
Auch heute bringt die Gefühlskälte und das schier grenzenlose Mobbing die beteiligten Verantwortlichen von Polizei und Jugendamt noch auf die Palme. Als „Vollkatastrophe“ bezeichnet Irmgard Stinzendörfer von der Stadt die Facebook-Gruppe. Stinzendörfer ist Sozialpädagogin und beim Amt für Kinder- und Jugendschutz unter anderem für das Thema Cybermobbing verantwortlich. Cybermobbing, das ist Internet-Neudeutsch für Beleidigungen, Verunglimpfungen, Bedrohungen und Belästigungen über das Netz. Es ist schwer zu sagen, inwieweit diese neuartigen Straftaten in Wuppertal in der letzten Zeit zu- oder abgenommen haben. Die Statistik der Polizei erfasst nur die Straftatbestände als solche, nicht aber, ob sie im Internet oder in der realen Welt vorgefallen sind. Ralf Weidner von der Wuppertaler Polizei wagt trotzdem eine Einschätzung: „An den Schulen ist Cybermobbing gefühlt sehr verbreitet“, sagt der Kriminalhauptkommissar. Für die Kriminalprävention der Polizei ist er im Jahr in rund 50 Klassen an 15 Schulen unterwegs. Dort klärt er über die Gefahren im Internet auf und gibt den Kindern Verhaltensrichtlinien.
Besonders schwierig ist, dass das Mobbing mit dem Schulgong nicht mehr aufhört, wie es früher war. Durch Handy, Messenger oder soziale Medien kommen Opfer nicht mehr aus dem Kreislauf heraus. Sie sind theoretisch 24 Stunden am Tag erreichbar. Oder können 24 Stunden lang ohne ihr Wissen vor einer großen Zahl von Lesern angegriffen werden. „Die Kinder haben keine Ruhe mehr. Letztendlich ist es auch schwierig, einmal Geschriebenes wieder aus dem Internet zu löschen. Und die Hemmschwelle für die Täter ist geringer, wenn sie am PC sitzen und keine Reaktion ihrer Opfer mitbekommen“, sagt Irmgard Stinzendörfer. Um sich nicht selbst ins Fadenkreuz zu bringen, sollten die Kinder genau überlegen, was sie wann wem schreiben. Sie sollten sich die Frage stellen, ob sie das, was sie da gerade ins Netz posten, auch auf einer großen Leinwand auf dem Schulhof schreiben würden. „Dieses Beispiel wirkt immer ganz gut“, sagt Stinzendörfer.
Aktiv im Thema
www.freiherr-knigge.de | Webseite von Benimm-Berater Moritz Freiherr Knigge
www.bündnis-gegen-cybermobbing.de | Verein Bündnis gegen Cybermobbing
www.bka.de | Das Bundeskriminalamt bietet Infos zu Internetkriminalität
Lesen Sie weitere Artikel
zum Thema auch unter: trailer-ruhr.de/thema und choices.de/thema
WELTENKINDER – Was bedeutet Kindsein heute? (Thema im September)
AutorInnen, Infos, Texte, Fotos, Links, Meinungen...
gerne an meinung@engels-kultur.de
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Gutes Netz, böses Netz
Gutes Netz, böses Netz
Erneuert oder zerstört die Digitalisierung die Demokratie? – THEMA 04/17 ZUKUNFT JETZT
 von en_thema_S2_Online_Didschuneit.jpg) „Unsere Demokratie entspricht nicht mehr den Umständen unseres Lebens“
„Unsere Demokratie entspricht nicht mehr den Umständen unseres Lebens“
Marina Weisband über Digitalisierung demokratischer Prozesser – THEMA 04/17 Zukunft jetzt
 Netz der Hemmungslosen
Netz der Hemmungslosen
Internet: Mülleimer der Wütenden und Frustrierten – THEMA 08/15 DIGITALIS
 „Affekt ist der Todfeind der Höflichkeit“
„Affekt ist der Todfeind der Höflichkeit“
Moritz Freiherr Knigge über gutes Verhalten im Internet – Thema 08/15 Digitalis
 Nur die Gedanken sind frei
Nur die Gedanken sind frei
Menschenrechtsorganisationen leisten Widerstand – Thema 08/15 Digitalis
 Nutzer-David gegen Goliath
Nutzer-David gegen Goliath
Was ist eigentlich mit der EU-Datenschutzrichtlinie? – Thema 08/15 Digitalis
Perfektes Versagen
Intro – Systemstörung
Die Hoffnung schwindet
Teil 1: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 1: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
Klimaprotest im Wandel
Teil 1: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 2: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 2: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
Dem Klima verpflichtet
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Initative Klimawende Köln
Welt statt Wahl
Teil 3: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 3: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
Klimaschutz braucht (dein) Engagement
Teil 3: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima
Klimaschutz als Bürgerrecht
Norwegen stärkt Engagement für Klimaschutz – Europa-Vorbild: Norwegen
Durch uns die Sintflut
Der nächste Weltuntergang wird kein Mythos sein – Glosse
Vorwärts 2026
Intro – Kopf oder Bauch?
Noch einmal schlafen
Teil 1: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 1: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
Weil es oft anders kommt
Teil 1: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 2: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 2: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne


